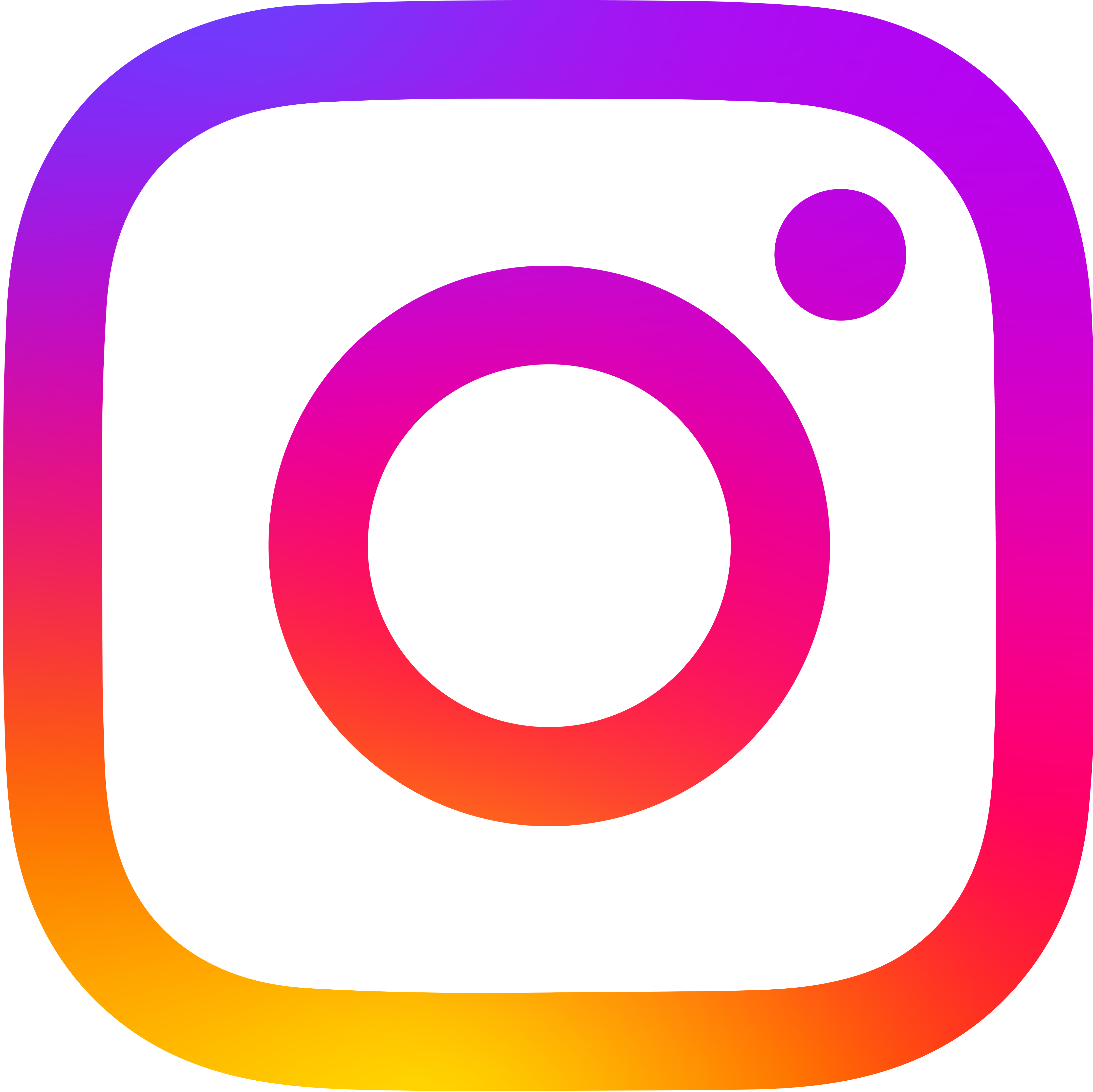Therapie
Medikamentöse Therapie bei EGPA
Behandlungsoptionen bei Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis
Die eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA) ist eine seltene Autoimmunerkrankung, die zu den entzündlich-rheumatischen Krankheiten gezählt wird. Die früher auch als Churg-Strauss-Syndrom bezeichnete chronische Erkrankung kann sich in vielen Organen bemerkbar machen und zeigt sich bei jedem Betroffenen anders. Durch Fortschritte in der Forschung stehen mittlerweile verschiedene Medikamente zur Behandlung der EGPA zur Verfügung. Bisher ist die EGPA dadurch zwar noch nicht heilbar, aber teils sehr gut behandelbar.

Neben nicht-medikamentösen Behandlungsmaßnahmen, die den Umgang mit der Erkrankung erleichtern können, stützt sich das Therapiemanagement vor allem auf medikamentöse Behandlungsformen. Internationale Leitlinien unterstützen den Arzt mit Empfehlungen bei der Auswahl einer geeigneten Therapie.1,2 Wie die Behandlung im Einzelnen aussieht, hängt von den Beschwerden sowie dem Schweregrad der Erkrankung ab. Der behandelnde Arzt wird die Therapie immer an die individuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse anpassen.
Ziel der medikamentösen Therapie ist es, das Entzündungsgeschehen unter Kontrolle zu bekommen, Schübe möglichst lang hinauszuzögern und die Lebensqualität zu verbessern.
Mit den Ärzten zusammenarbeiten
NP-DE-MPL-OGM-230002, Feb23
Medikamentöse Therapieoptionen auf einen Blick1,2
.png)
Glukokortikoide
Glukokortikoide, häufig auch Kortison genannt, werden bei zahlreichen chronischen Erkrankungen eingesetzt. Die Hormone zählen zu den Steroiden und bilden die Basis der EGPA-Therapie. Durch ihre Wirkung auf das Immunsystem und die Stoffwechselprozesse des Körpers, können Entzündungen gelindert und Krankheitsschübe gebremst werden. Gerade zu Beginn der Behandlung werden häufig hohe Dosierungen verabreicht, um die Erkrankung zur Ruhe zu bringen. Dafür sind sie sehr gut geeignet. Langfristig sollten aufgrund möglicher Nebenwirkungen idealerweise Therapieformen gewählt werden, die eine Reduktion oder ein komplettes Ausschleichen des Kortisons ermöglichen.
.png)
Immunsuppressiva
Bei Immunsuppressiva handelt es sich um Medikamente, die die nicht gewünschten Reaktionen des Immunsystems unterdrücken. Die Präparate können natürlichen oder künstlichen Ursprungs sein. Zu den bekanntesten Vertretern gehören Azathioprin, Methotrexat und Mycophenolat-Mofetil. Da die Wirkung des Immunsystems herabgesetzt wird, kann es zu einem erhöhten Infektionsrisiko kommen. Zudem sollten regelmäßige Kontrollen der inneren Organe und des Blutbildes erfolgen. Mehr über mögliche Nebenwirkungen bei Immunsuppressiva hier.
.png)
Zielgerichtete Therapien mit Antikörpern
Relativ neu ist der Einsatz zielgerichteter Therapien mit Antikörpern in der EGPA-Behandlung. Diese Therapieform bekämpft nicht die Symptome, sondern setzt an der eigentlichen Ursache an. Die sogenannten monoklonalen Antikörper werden mit Hilfe bestimmter einzigartiger B-Lymphozyten hergestellt, die genetisch verändert werden.3 Bei den Antikörpern handelt es sich um große Moleküle mit einer sehr komplexen Struktur. Sie erkennen die für die Entzündung verantwortlichen Botenstoffe oder Zellen und bekämpfen diese, indem sie sich an sie binden und sie so blockieren. Die Botenstoffe können sich nicht mehr an die Gewebezellen binden, sodass das Entzündungssignal unterbrochen wird. Entsprechend greifen Antikörper gezielt in den Mechanismus der Erkrankung ein und beeinträchtigen nicht das gesamte Immunsystem. Auf diese Weise können die Entzündungsredaktionen gemindert und das Risiko von Organschäden reduziert werden. Dennoch kann es auch hier zu Nebenwirkungen kommen.

Chemotherapie
Chemotherapie klingt im ersten Moment für viele Betroffene eher bedrohlich. Eigentlich bedeutet es aber nichts anderes, als die Behandlung mit einem Zytostatikum. Zytostatika sind chemische Substanzen, die Körperzellen vernichten und/oder sie an ihrer Vermehrung hindern. Im Fall der EGPA wird in der Regel Cyclophosphamid verwendet. Das Zytostatikum wird auch als Immunsuppressivum eingesetzt, da es die normale Funktion des Immunsystems unterdrückt. Die häufig gefürchteten Nebenwirkungen einer Chemotherapie, wie beispielsweise der Haarausfall, treten hier nur sehr selten auf. Diese Maßnahme wird nur bei einem schweren Verlauf der EGPA angewendet, wenn die Organfunktion bedroht ist.
Du hast Fragen zu deiner Behandlung?
Mache dir Notizen und sprich sie beim nächsten Arztbesuch an!
Wichtige Faktoren für die Therapieentscheidung
Da die EGPA ein sogenanntes heterogenes Erscheinungsbild hat, sich also von Patient zu Patient sehr unterscheiden kann, gibt es nicht die eine EGPA-Therapie. Vielmehr wird das Behandlungsmanagement individuell angepasst und basiert auf mehreren Faktoren:
- Die Betrachtung der individuellen Symptome und Beschwerden
- Die Entwicklung der Symptome im Krankheitsverlauf – Wichtig: Dafür können weitere Untersuchung notwendig sein
- Auswirkungen auf die Lebensqualität
- Die Einbeziehung von Komedikationen
Die individuelle Behandlung sowie regelmäßige Überprüfung und bei Bedarf Anpassung der Therapie ermöglicht einen optimierten Umgang mit der Erkrankung. Dafür ist eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit deiner behandelnden Ärztin / deinem behandelnden Arzt unerlässlich.
Tipp
EGPA-Patienten werden oft von verschiedenen Fachärzten betreut, die verschiedene Auswirkungen der EGPA behandeln. Daher kann es hilfreich sein, alle wichtigen Informationen griffbereit zu haben. Notiere dir in einem Tagebuch deine Medikamente, die Dosis und die Dauer der Anwendung. So behältst du einen Überblick über deine Behandlung und bist für deinen nächsten Arztbesuch gut vorbereitet.

Nebenwirkungen (NW)
EGPA führt zu einer Fehlregulation des Immunsystems und Entzündungen in verschiedenen Organen. Für die Therapie werden Medikamente eingesetzt, die die übermäßige Immunreaktion unterdrücken und die entzündlichen Prozesse kontrollieren sollen. Sie tragen dazu bei, die Symptome zu lindern und das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Diese Medikamente haben verschiedene potentielle Nebenwirkungen und nicht immer sind Erkrankungssymptome und Nebenwirkungen klar voneinander unterscheidbar.
Du möchtest mehr darüber erfahren? Klicke auf die untenstehenden Begriffe für mehr Informationen über allgemeine Nebenwirkungen. Bei Fragen zu individuellen Risiken und Nebenwirkungen kann dein Arzt/deine Ärztin dich beraten.
Nebenwirkungen erkennen
Ob Nebenwirkungen der Therapie, eine zusätzliche Infektion oder EGPA-Symptome – die Ursache für Beschwerden ist selbst für Spezialisten nicht immer einfach zu erkennen.
Insbesondere bei Infektionen gibt es einiges zu beachten: Bei einer aktiven Grunderkrankung besteht eine verminderte Abwehr gegenüber Viren und Bakterien durch beispielsweise Sekretstau und Schwellung in der Nasenschleimhaut, was die Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen erhöht. Eine Infektion der Atemwege kann andererseits aber auch eosinophile Zellen in den Schleimhäuten stimulieren, sodass möglicherweise nach dem Infekt kurzzeitig eine verstärkte Therapie der EGPA-Grunderkrankung erforderlich wird.
Hinweis bei Therapiewechsel und Kombination verschiedener Medikamente
Der Wechsel und die Ergänzung verschiedener Medikamente sollten immer in engem Austausch mit dem Arzt/ Ärztin erfolgen, um potentielle Symptome zu kontrollieren und zu behandeln.
Erfahre hier mehr darüber, was bei einer Komedikation wichtig sein kann.
Fazit
Ein detaillierter und regelmäßiger Austausch mit dem Arzt/der Ärztin kann helfen, EGPA-Symptome, Nebenwirkungen oder Symptome zusätzlicher Erkrankungen zu erkennen und einzuordnen. Auch du kannst dabei helfen! Dokumentiere dein Befinden in einem Patiententagebuch. So hast du alle wichtigen Informationen für den nächsten Arzttermin griffbereit.
Weiterführende Untersuchungen
Da die Erkrankung in Schüben verläuft und sich die Symptome im Laufe der Zeit verändern können, wird die Behandlung regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Es stehen unterschiedliche Maßnahmen zur Verfügung, die alleine oder in Kombination angewendet werden können.
Referenzen
1. Hellmich, B. et al. Ann Rheum Dis. 2023 Mar 16; ard-2022-223764.
2. Dh Chung, S.A. et al. Arthritis Rheumatol. 2021; Aug; 73(8): 1366-1383. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34235894/. Letzter Zugriff am 16.08.2023.
3. https://flexikon.doccheck.com/de/Monoklonaler_Antikörper. Letzter Zugriff am 16.08.2023.
4. Price DB, et al. J Asthma Allergy. 2018 Aug 29;11:193-204.
5. Strehl C, et al. Ann Rheum Dis. 2016 Jun;75(6):952-7.
6. Younger IR, et al. J Am Acad Dermatol. 1991;25:281-286.
7. Dan D, et al. Swiss Med Wkly. 2014;144:w14030.
8. Singh S, et al. Curr Clin Pharmacol. 2018;13(2):85-99.
9. Castelli MS, et al. Pharmacol Res Perspect. 2019 Dec;7(6):e00535.
10. https://flexikon.doccheck.com/de/Cyclophosphamid. Letzter Zugriff am 22.02.2024.
NP-DE-MPL-WCNT-240023, März24